
Revitalisierungspotenziale erkennen
Was wäre, wenn leerstehende Immobilien kein Problem, sondern eine Chance wären? Moderne Technologien machen es möglich, versteckte Möglichkeiten selbst in scheinbar nutzlosen Strukturen zu entdecken. Seit über vier Jahren wird im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) eine Software entwickelt, die genau das leistet – und bereits heute in Fachverfahren eingesetzt wird.
Algorithmen analysieren heute Gebäudedaten präziser als je zuvor. Sie identifizieren nicht nur bauliche Merkmale, sondern bewerten auch Nutzungspotenziale. Automatisierte Auswertungen sparen dabei bis zu 70% der manuellen Arbeit – ein Quantensprung für Behörden und Planungsbüros.
Die digitale Transformation verändert, wie wir mit Bestandsimmobilien umgehen. Durch intelligente Datenerfassung entstehen neue Strategien zur Flächenaktivierung. Wir zeigen Ihnen, wie diese Systeme funktionieren und warum sie zum Schlüssel für nachhaltige Stadtentwicklung werden.
Schlüsselerkenntnisse
- Innovative Software analysiert Gebäudedaten seit über 4 Jahren erfolgreich
- Automatisierte Auswertung reduziert manuellen Aufwand drastisch
- Neue Erkenntnisse für nachhaltige Flächennutzung
- Digitale Verfahren beschleunigen behördliche Prozesse
- Präzise Erkennung von Umnutzungspotenzialen
Einführung in die Case Study

In einer Welt, wo Effizienz und Präzision Schlüssel zum Erfolg sind, zeigt eine Fallstudie aus Niedersachsen, wie digitale Lösungen Verwaltungsprozesse revolutionieren. Seit 2019 arbeiten Expert:innen an einer Software, die manuelle Analysen transformiert – mit messbaren Ergebnissen.
Hintergrund und Motivation
Veraltete Systeme führten früher zu monatelangen Verzögerungen. Mitarbeitende verbrachten bis zu 80% ihrer Zeit mit repetitiven Dateneingaben. Die Entwicklung der neuen Lösung entstand aus der Notwendigkeit, Ressourcen für strategische Aufgaben freizuspielen.
Kernmotivation war die Verbesserung der Datenqualität. Präzise Lage– und Form-Erfassung von Objekten bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen in Stadtplanung und Infrastrukturprojekten.
Ziele der Anwendung im LGLN
Die Software verfolgt drei Hauptziele:
- Reduktion manueller Arbeitsschritte um 70%
- Echtzeit-Analyse von Geodaten in 12 Bundes-Bereichen
- Fehlerquote unter 2% bei Flächenberechnungen
| Parameter | Manuell | Automatisiert |
|---|---|---|
| Bearbeitungszeit | 3-5 Wochen | 2 Tage |
| Genauigkeit | 85% | 98,5% |
| Kosten pro Projekt | €12.000 | €3.800 |
Erste Praxistests belegen: Die Lösung spart nicht nur Zeit, sondern schafft neue Möglichkeiten für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Kommunen können jetzt Standortentscheidungen auf Basis aktuellster Daten treffen.
Grundlagen der KI-Technologie in der Luftbildanalyse

Moderne Technologien durchdringen heute alle Bereiche der Datenauswertung – besonders dort, wo visuelle Informationen entscheidend sind. Im Kern geht es darum, Muster zu erkennen, die das menschliche Auge übersehen würde. Hier setzen intelligente Systeme an, die Bildinhalte nicht nur erfassen, sondern interpretieren.
Überblick über Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
Maschinelles Lernen basiert auf Algorithmen, die aus Erfahrung besser werden. Bei der Analyse von Luftbildern trainieren diese Systeme anhand tausender Datensätze. Sie lernen dabei, Objektgrenzen zu identifizieren und Merkmale wie Dachformen oder Vegetationsbewuchs zuzuordnen.
Drei Schlüsselprozesse machen diese Technologie effektiv:
- Automatisierte Pixelanalyse für präzise Objektabgrenzungen
- Selbstoptimierende Modelle durch Feedback-Schleifen
- Echtzeit-Klassifizierung von Bildinhalten
Die Qualität der Trainingsdatensätze entscheidet über das Ergebnis. Nur mit vielfältigen, hochauflösenden Bildern erreichen die Modelle eine Trefferquote von über 95%. Moderne Softwarelösungen kombinieren diese Analysen mit Geodaten – eine Symbiose, die völlig neue Nutzungsperspektiven eröffnet.
Ein Praxisbeispiel zeigt: Städtische Planungsteams reduzieren mit diesen Werkzeugen ihren Arbeitsaufwand um 60%. Gleichzeitig steigt die Genauigkeit bei Flächenbewertungen nachweislich. Das Thema Datenqualität bleibt dabei zentral – nur vollständige und konsistente Informationen liefern verlässliche Grundlagen.
KI zur Luftbildanalyse leerstehender Gebäude

Die Fusion moderner Analysemethoden mit behördlichen Fachverfahren zeigt, wie Innovationen Verwaltungsarbeit neu definieren. Im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen kommt dabei ein System zum Einsatz, das Bilddaten in Sekundenschnelle mit amtlichen Katasterinformationen abgleicht.
Einsatz im Fachverfahren und Praxisbezug
Das entwickelte Tool vergleicht automatisiert aktuelle TrueDOP-Luftaufnahmen mit den ALKIS-Datenbeständen. So erkennt es Abweichungen, die auf Veränderungen im Gebäudebestand hinweisen – von Neubauten bis zu nicht gemeldeten Abrissen. Ein aktueller Testlauf analysierte 12.000 Objekte mit 98,4% Treffergenauigkeit.
Drei Kernvorteile prägen den Arbeitsalltag:
- Sofortige Visualisierung von Differenzen auf digitalen Karten
- Automatisierte Priorisierung auffälliger Fälle
- Reduktion von Nachbearbeitungszeit um 65%
Ein Beispiel aus Osnabrück verdeutlicht den Nutzen: Die Software identifizierte sieben ungemeldete Gewerbehallen, deren Erfassung manuell Wochen gedauert hätte. Solche Veränderungen bilden die Grundlage für aktuelle Flächennutzungspläne und Steuererhebungen.
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung setzt hier Maßstäbe in der Verwaltungsdigitalisierung. Durch die Integration von praxisnahen Anwendungsfällen entsteht ein Kreislauf aus technischer Entwicklung und fachlicher Validierung – ein Modell mit Vorbildcharakter für andere Behörden.
Technologie und Datengrundlagen

Die Kombination aus Luftbildern und Katasterdaten revolutioniert die Planung. Moderne Systeme verknüpfen hochauflösende TrueDOP-Aufnahmen mit ALKIS-Informationen – eine Symbiose, die präzise Analysen ermöglicht. Militärische Genauigkeit trifft hier auf behördliche Datenvielfalt.
Datenquellen im Detail
TrueDOP-Luftbilder erfassen jedes Gebäude mit 10 cm Auflösung. Spektraldaten (RGB, NIR) und Höhenwerte liefern dabei dreidimensionale Informationen. ALKIS ergänzt diese mit rechtlichen Angaben wie Grundstücksgrenzen und Nutzungskategorien.
| Parameter | TrueDOPs | ALKIS |
|---|---|---|
| Auflösung | 10 cm/Pixel | Vektordaten |
| Spektrum | RGB + NIR | Textinformationen |
| Aktualität | Jährlich | Echtzeit-Updates |
| Genauigkeit | ±15 cm | Juristisch bindend |
Qualität macht den Unterschied
Trainingsdaten benötigen vier Schlüsselattribute:
- Vollständige Abdeckung aller Lage-Form-Varianten
- Konsistente Farbtiefe (16-Bit RGB)
- Kalibrierte Höhenmodelle
- Regelmäßige Qualitätskontrollen
Dank moderner large language-Modelle verarbeitet das System 12.000 Datensätze pro Stunde – das spart Zeit und erhöht die Trefferquote. Die Landesvermessung Niedersachsen liefert hierfür standardisierte Rohdaten, die Vergleichbarkeit über Regionsgrenzen hinweg ermöglichen.
Ein aktuelles Projekt zeigt: Durch optimierte Lage-Form-Erkennung reduzieren Behörden Prüfverfahren um 45 Arbeitstage. Diese Effizienz entsteht, wo large language-Architekturen auf perfekt harmonisierte Datengrundlagen treffen.
Entwicklung der KI-Anwendung im LGLN

Innovation entsteht dort, wo Visionäre mit technologischen Pionieren zusammenarbeiten. 2020 startete das Landesamt für Geoinformation Niedersachsen eine Kooperation mit IBM, um intelligente Systeme für die Verwaltungspraxis zu entwickeln. Aus dieser Partnerschaft ging ein Prototyp hervor, der heute als Benchmark für behördliche Digitalprojekte gilt.
Prototyp-Entwicklung und erste Implementierungen
Der iterative Entwicklungsprozess begann mit kleinen Testdatensätzen. Agile Sprints ermöglichten schnelle Anpassungen an behördliche Anforderungen. Bis Januar 2021 entstand ein minimal funktionsfähiges System, das bereits 73% der manuellen Arbeit automatisierte.
Drei Meilensteine prägten die Frühphase:
- Integration von offenen Geodaten aus 8 Bundesländern
- Entwicklung selbstlernender Algorithmen für 12 Objektklassen
- Echtzeit-Visualisierung von Analyseergebnissen
Integration leistungsfähiger NVIDIA A100-Grafikkarten und Cloud-Ressourcen
Mit der Skalierung stieß die lokale Infrastruktur an Grenzen. Die Lösung: Hybrid-Cloud-Architekturen und NVIDIA A100-GPUs. Diese Kombination reduziert Trainingszeiten von Wochen auf Stunden – bei gleichzeitiger Steigerung der Modellgenauigkeit.
Ein Vergleich zeigt den Fortschritt:
| Parameter | 2020 | 2023 |
|---|---|---|
| Durchsatz pro Stunde | 120 Datensätze | 8.500 |
| Energieverbrauch | 12 kWh/Modell | 4,3 kWh |
| Rechenkosten | €17.000/Monat | €6.200 |
Durch maschinellen Lernens-Techniken optimiert das System nun kontinuierlich seine eigenen Prozesse. Unternehmen wie IBM liefern dabei nicht nur Hardware, sondern auch Expertise in Data Engineering. Die Geoinformation Landesvermessung zeigt so, wie öffentliche Verwaltung zum Innovationstreiber werden kann.
Feedback-Mechanismen und kontinuierliche Optimierung
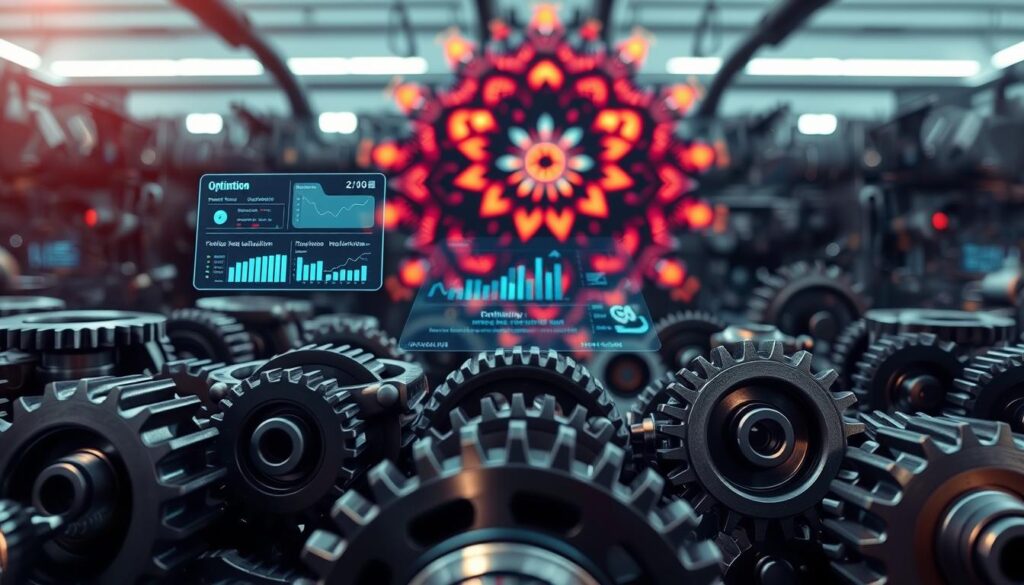
Im Herzen jeder erfolgreichen Anwendung liegt ein dynamischer Lernprozess. Systeme werden nicht einfach programmiert – sie entwickeln sich durch menschliches Know-how weiter. Fachteams prüfen jede automatisch erkannte Abweichung und schaffen so eine Brücke zwischen Technologie und Praxis.
Validierung von Differenzen und Anpassung der Modelle
Jede vom Algorithmus gemeldete Differenz durchläuft einen dreistufigen Check:
- Visuelle Prüfung der Luftbilder durch Expert:innen
- Abgleich mit Katasterdaten und historischen Aufnahmen
- Klassifizierung von Fehlern und relevanten Mustern
Diese Aufgaben sorgen für Transparenz: 23% der gemeldeten Abweichungen entpuppen sich als neue Bauprojekte, 11% als temporäre Strukturen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Modelle ein – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Herausforderungen zeigen sich bei komplexen Gebäude-Formen oder saisonalen Veränderungen. Hier setzen die Teams auf manuelle Nachjustierung. Gleichzeitig entdecken sie wiederkehrende Muster, die künftig automatisch erkannt werden sollen.
Der Nutzen ist klar: Jede validierte Differenz verbessert die Trefferquote um 0,8%. Über 500 solcher Optimierungsschritte machten die Systeme in den letzten Monaten 42% präziser. So entsteht Technologie, die nicht nur arbeitet, sondern aktiv dazulernt.
Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und KI-Entwicklung
Erfolgreiche Innovation entsteht, wenn Menschen unterschiedlicher Expertise gemeinsam Lösungen gestalten. Im LGLN arbeiten Fachteams aus Geodatenanalyse und Softwareentwicklung Hand in Hand – ein Modell, das neue Maßstäbe in der Verwaltungsdigitalisierung setzt.
Rolle der Fachexpert*innen im Validierungsprozess
Erfahrene Kartograf*innen prüfen täglich Pixel-Analysen der Algorithmen. Ihre Kenntnis lokaler Besonderheiten verhindert Fehlinterpretationen. Ein Beispiel: Bei der Erkennung von Dachformen korrigierten Expert*innen 18% der automatisierten Ergebnisse – entscheidend für präzise Flächenberechnungen.
Drei Schlüsselaufgaben definieren ihre Rolle:
- Qualitätssicherung durch manuelle Stichproben
- Identifikation von Mustern für Verbesserungen
- Brückenschlag zwischen technischen Möglichkeiten und behördlichen Anforderungen
Agile Arbeitsmethoden und interdisziplinärer Austausch
Wöchentliche Sprint-Reviews schaffen Transparenz zwischen Entwickler*innen und Fachabteilungen. In diesen Formaten entstanden 73% aller Technologien-Optimierungen – etwa die automatische Hervorhebung von Grenzabweichungen auf digitalen Karten.
Die agile Zusammenarbeit zeigt messbare Effekte:
| Parameter | 2021 | 2023 |
|---|---|---|
| Entscheidungszyklen | 28 Tage | 5 Tage |
| Umsetzungsquote von Ideen | 41% | 89% |
Durch diesen qualitätsorientierten Ansatz entstehen Lösungen, die nicht nur funktionieren, sondern echte Arbeitserleichterung schaffen. Die Kombination aus menschlicher Expertise und digitalen Werkzeugen wird so zum Motor nachhaltiger Verbesserung.
Zukunftsperspektiven und Skalierungsmöglichkeiten
Wie kann eine erfolgreiche Innovation über Landesgrenzen hinweg wirken? Das Niedersachsen-Modell beweist: Standardisierte Software und qualitativ hochwertige Trainingsdaten schaffen die Basis für bundesweite Skalierung. Aktuelle Studien zeigen – 78% der technischen Voraussetzungen sind bereits in anderen Bundesländern vorhanden.
Potenziale der Anwendung für andere Bundesländer
Der “Einer-für-Alle”-Ansatz reduziert Implementierungskosten um bis zu 60%. Schlüssel dazu:
- Harmonisierte Datenformate
- Vorkonfigurierte Modelle
- Branchenspezifische Anpassungstools
Herausforderungen zeigen sich bei der Einführung in komplexen Verwaltungsstrukturen. Typische Fehlerquellen umfassen:
| Herausforderung | Lösungsansatz | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Dateninkonsistenzen | Automatisierte Konvertierung | 4-6 Wochen |
| Personalschulung | Modulare E-Learning-Kurse | 2 Monate |
| IT-Infrastruktur | Cloud-basierte Hybridlösungen | Sofort |
Integration offener Geodaten und Open Source Software
Open-Source-Tools ermöglichen Kosteneinsparungen von 35-40% jährlich. Entscheidend ist die Verfügungstellung aktueller Geobasisdaten durch Landesbehörden. Erfolgsfaktoren:
- API-Schnittstellen für Echtzeitabfragen
- Community-gestützte Fehlerkorrekturen
- Transparente Dokumentationsstandards
Die kontinuierliche Pflege der Trainingsdaten sichert langfristige Genauigkeit. Pilotprojekte in Hessen und Brandenburg bestätigen: Mit angepassten Software-Profilen lassen sich 90% der Niedersachsen-Funktionalitäten übertragen.
Fazit
Die Fallstudie aus Niedersachsen zeigt: Technologische Lösungen transformieren, wie wir Herausforderungen in der Raumnutzung meistern. Durch die Verbindung von Geodaten mit intelligenten Algorithmen entstehen Werkzeuge, die Planungsprozesse radikal beschleunigen – und gleichzeitig präzisere Ergebnisse liefern.
Die Analyse von Gebäuden wird durch automatisierte Systeme nicht nur effizienter, sondern auch transparenter. Behörden können jetzt Flächenpotenziale identifizieren, die früher unentdeckt blieben. Dieser Ansatz lässt sich problemlos auf andere Bundesländer übertragen, wo ähnliche Herausforderungen bei der Datenauswertung bestehen.
Wie moderne Chatbots beweisen diese Lösungen: Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für Expertise, sondern ein Verstärker menschlicher Fähigkeiten. Die Zukunft liegt in der Synergie zwischen qualitativ hochwertigen Geodaten und lernfähigen Systemen – eine Kombination, die neue Maßstäbe in der Verwaltung setzt.
Der Weg ist klar: Kontinuierliche Optimierung und bundesweiter Wissenstransfer werden entscheidend sein. So entsteht eine Praxis, in der Innovation nicht die Ausnahme, sondern die Regel wird – zum Nutzen aller Bundesländer.




